Pro und Contra
Sollen wir mehr und länger arbeiten?

Ulrich Körtner: Ja!
 Bezogen auf die Situation in Deutschland – ich selber lebe in Österreich, wo die Probleme freilich ähnlich gelagert sind – muss die Antwort lauten: Ja. Die Herausforderungen auf dem Weltmarkt, demografischer Wandel, der zunehmende Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und sinkende Produktivität bei gestiegener Lebenserwartung legen das nahe.
Bezogen auf die Situation in Deutschland – ich selber lebe in Österreich, wo die Probleme freilich ähnlich gelagert sind – muss die Antwort lauten: Ja. Die Herausforderungen auf dem Weltmarkt, demografischer Wandel, der zunehmende Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und sinkende Produktivität bei gestiegener Lebenserwartung legen das nahe.
Visionen von einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich – begründet mit dem Argument, mit sinkender Wochenarbeitszeit würden das Wohlbefinden, die Freude an der Arbeit und damit auch die Produktivität steigen – gehören wohl ebenso ins Reich des Wunschdenkens wie die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Wobei schon richtig ist, dass nicht die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, sondern die Produktivität pro Arbeitsstunde, die Höhe der Krankenstände und eine durch belastende Faktoren im Job verursachte Arbeitsunfähigkeit mit zu bedenken sind. Natürlich gilt dies auch von Effizienzsteigerung aufgrund technologischer Innovation. Letztlich aber führt angesichts des demografischen Wandels kein Weg an einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit vorbei – mit Ausnahmen für Berufsgruppen mit schwerer körperlicher Belastung.
De facto wird ohnehin mehr und länger gearbeitet – allerdings nicht unbedingt in angemeldeten Beschäftigungsverhältnissen, sondern in Form von Schwarzarbeit und Nachbarschaftshilfe. Die Forderung, mehr und länger zu arbeiten, läuft ins Leere, wenn Erwerbsarbeit als solche nicht attraktiver wird. Problematisch ist die Zunahme der Teilzeitbeschäftigung. Besonders drängend sind die Probleme im Gesundheitssektor, namentlich in der Pflege. Sinkende Personalstände erhöhen den Arbeitsdruck, der auf den Einzelnen lastet. Die Debatte um die Zukunft der Arbeit darf sich aber nicht auf den Erwerbssektor beschränken. Wir müssen auch über die unbezahlte Familienarbeit – zumeist weiblich – und ehrenamtliche Tätigkeiten sprechen.
Mehr und länger arbeiten, um den Wohlstand zu sichern, ist letztlich eine Frage der sozialen und intergenerationellen Gerechtigkeit. Um den Sozialstaat zu erhalten und die Renten der nächsten Generationen zu sichern, sind die Produktivität und die Solidarität derer gefordert, die dazu in der Lage sind. Das entspricht christlichen Grundsätzen. Lebenssinn und Selbstwert hängen freilich weder im Beruf noch in der Freizeit allein am Tätigsein, sondern an der Erfahrung der Güte Gottes. »Was hast du, das du nicht empfangen hast?« (1. Korinther 4,7) Die Würde jedes Menschen und das Recht auf Leben bestehen unabhängig von allen Leistungen. Arbeit ist bestenfalls das halbe Leben.
Franz Segbers: Nein!
 Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance könne Deutschland seinen Wohlstand nicht erhalten; es müsse mehr gearbeitet werden. Der Vorwurf von Bundeskanzler Merz, die Menschen seien zu faul, widerspricht den Fakten und ist erstaunlich ignorant. Die Beschäftigtenzahl erreicht gerade einen Höchststand; Deutschland ist mit 552 Millionen bezahlten und 638 Millionen unbezahlten Überstunden Europameister. Da aber jede zweite erwerbstätige Frau teilzeitbeschäftigt ist, sieht die durchschnittliche Jahresarbeitszeit im europäischen Vergleich relativ gering aus.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance könne Deutschland seinen Wohlstand nicht erhalten; es müsse mehr gearbeitet werden. Der Vorwurf von Bundeskanzler Merz, die Menschen seien zu faul, widerspricht den Fakten und ist erstaunlich ignorant. Die Beschäftigtenzahl erreicht gerade einen Höchststand; Deutschland ist mit 552 Millionen bezahlten und 638 Millionen unbezahlten Überstunden Europameister. Da aber jede zweite erwerbstätige Frau teilzeitbeschäftigt ist, sieht die durchschnittliche Jahresarbeitszeit im europäischen Vergleich relativ gering aus.

Nun will die Bundesregierung eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit einführen. Dabei ist heute schon der Achtstundentag keine Höchstgrenze, sondern vielmehr Ausgangspunkt für eine Vielfalt von Flexibilisierungen. Nicht längere Arbeitszeiten, auch nicht mehr Flexibilisierung, sondern vor allem eine kürzere Erwerbsarbeitszeit kann helfen, Beruf und Familie besser zu vereinbaren.
Allen Diffamierungen der 4-Tage-Woche zum Trotz: Sie ist keine Utopie mehr. Immer mehr Unternehmen und öffentliche Dienststellen in vielen Ländern führen sie erfolgreich ein. Die Vorteile einer kürzeren Arbeitswoche bei Lohnausgleich sind empirisch gut belegt: Die Beschäftigten sind zufriedener und gesünder, die Unternehmen oft produktiver und effizienter.
Fatal ist das verstaubte Arbeitsverständnis von Merz: Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit. Auch die Sorge um Kinder oder pflegebedürftige Menschen ist Arbeit. Wer Arbeit auf Erwerbsarbeit verengt, wertet Tätigkeiten ab, die kein Wirtschaftswachstum erbringen. Studien belegen, dass die Menschen für die Carearbeit sogar fast doppelt so viele Stunden aufwenden wie für die Erwerbsarbeit. Durchschnittlich liegt die Erwerbsarbeitszeit heute bei nur etwa 30 Stunden. Diese Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich erfolgt jedoch insbesondere auf dem Rücken der Frauen, die erst durch Teilzeitarbeit die Sorgearbeit lebbar machen. Die Gesellschaft ist aber neben der Carearbeit auf weitere wichtige Tätigkeiten angewiesen: auf zivilgesellschaftliches Engagement in Parteien, Gewerkschaften, Kirchen.
Eine kurze Erwerbsarbeitsvollzeit ist zeitgemäß und sollte normal werden. Es ist an der Zeit, Lohn-, Care- und zivilgesellschaftliche Arbeit in ihrer Gesamtheit ernst zu nehmen. Weniger Erwerbsarbeit ermöglicht mehr an ganzer Arbeit für alle. Was Merz als »Work-Life-Balance« abtut, bietet die Chance, Lohn- und Sorgearbeit geschlechtergerecht besser zu verteilen sowie Familie und Beruf leichter vereinbar zu machen. Die 4-Tage-Woche ist technologisch machbar und ökonomisch vernünftig. Es lohnt sich, um sie zu kämpfen.
Ulrich Körtner ist Ordinarius für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und Institutsvorstand.
Franz Segbers ist emeritierter Professor für Sozialethik an der Universität Marburg.
Sollen wir mehr und länger arbeiten?



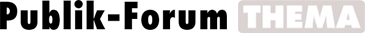


Thomas Bartsch-Hauschild 21.08.2025, 10:52 Uhr:
Faulheit können wir uns leisten- weil der technische Fortschritt und Computer die Produktivität,also zeitaufwendige Handarbeit fast überflüssig gemacht hat.
Trotzdem werden regelmäßig Überstunden gemacht. Zurück in die 1950iger will niemand mehr.
Josef Christian Aigner 18.07.2025:
Gut, dass Publik-Forum dem Pro-Kommentar von Ulrich Körtner für eine Verlängerung der Arbeitszeit einen fundierten Contra-Part von Franz Segbers gegenübergestellt hat, der sich kritisch gegen die konservativen Rufe nach Verlängerung der Jahres- und Lebensarbeitszeit ausspricht. Körtners Entwertung der Viertagewoche und erst recht des bedingungslosen Grundeinkommens als realitätsfernes »Wunschdenken« ist befremdlich, da man von einem Theologieordinarius schon erwarten dürfte, dass er sich zuvor sachkundig macht. Das gilt für die von Segbers erwähnten erfolgreichen Versuche und Studien zur Viertagewoche. Noch mehr gilt es für das von dem Innsbrucker Theologen Herwig Büchele (gemeinsam mit Liselotte Wohlgenannt) schon 1990 begründete Modell des »Grundeinkommens ohne Arbeit« (Europa Verlag). Auch Bücheles Nachfolger an der Spitze der Katholischen Sozialakademie Österreichs, Markus Schlagnitweit, zeigt, dass diese Forderung »fest auf dem Boden der katholischen Soziallehre« steht. Gut: Körtner ist evangelischer Theologe, aber in Zeiten der Ökumene und aus fachlicher Redlichkeit kann man doch davon ausgehen, dass auch ein Protestant sich mit grundlegenden gesellschaftspolitischen Ansätzen der katholischen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzt – bevor er das Lied der Sicherung eines (ohnehin fragwürdigen) Wohlstands gemeinsam mit den Konservativen singt.
Adalbert Kirchgäßner 18.07.2025:
Bundeskanzler Friedrich Merz ist der Meinung, die Deutschen müssten mehr arbeiten, also sagt er: Die Deutschen sind faul. Diesem Argument schießt sich Ulrich Körtner an. Aber faul ist, wer das Regierungsnarrativ nachplappert und eine »theologische« Pseudobegründung nachschiebt, statt die Ursachen des Finanzmangels zu benennen: die fortlaufende »Entlastung« der Reichen. Die Argumentation des Herrn Körtner ist ein neoliberales Glaubensbekenntnis. Mit der Sicht Jesu, die Welt aus der Sicht der Armen zu betrachten, hat das nichts zu tun. Sie kann allenfalls noch als armselige staatskirchliche Argumentation durchgehen.
Sibylle Brosius 18.07.2025:
Der größte Teil des existierenden Arbeitskräftemangels kann nur durch geeignete Rahmenbedingungen behoben werden. Die Einhaltung der täglichen Arbeitszeit basiert nämlich auf Gründen der Betriebssicherheit: Überlange Arbeitszeiten führen verstärkt zu Unfällen und Fehlern. Insofern sollte das überhaupt nicht diskutiert werden. Die geringere Durchschnittszahl von geleisteten Arbeitsstunden beruht auf einer hohen Teilzeitquote insbesondere von Frauen. Das Problem lässt sich nur durch bessere Kinderbetreuung und Pflege lösen. Es fehlen vor allem Facharbeiter und Pflegekräfte. Bessere Schul- und Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen werden gebraucht! Abgesehen davon: eine Viertagewoche lässt Raum, um die Vernachlässigung der öffentlichen Infrastruktur, zunehmende Hitze und dysfunktionale Kinder- und Jugendbetreuung zu managen und Ehrenämter wie Mitarbeit bei Vereinen und Gemeindearbeit wahrzunehmen.
Georg Lechner 20.06.2025, 16:31 Uhr:
Die zunehmende Automatisierung in der industriell - gewerblichen Produktion hat vor wenigen Jahren noch zur Frage geführt, wie man den Rückgang der Erwerbsarbeitsmöglichkeiten sozialverträglich managen kann. Andererseits haben die schlecht entlohnten und oft prekären Arbeitsverhältnisse im Dienstleistungssektor zugenommen, was sich negativ auf die Finanzierung des Gesundheitswesens und der Pensionen ausgewirkt hat und die Inlandsnachfrage einbrechen ließ. Eine Erhöhung der Arbeitszeit erhöht nur die Gewinne der Aktionäre auf Kosten der Allgemeinheit.
Sibylle Brosius 18.06.2025, 13:15 Uhr:
Diese Debatte ist eine Geisterdebatte und soll nur Druck erzeugen. Der größte Teil des existierenden Arbeitskräftemangels kann nur durch geeignete Rahmenbedingungen behoben werden. Die Einhaltung der täglichen Arbeitszeit basiert nämlich auf betriebssicherheitlichen Gründen: Überlange Arbeitszeiten führen verstärkt zu Unfällen und Fehlern. Insofern sollte das überhaupt nicht diskutiert werden. Die geringere Durchschnittszahl von geleisteten Arbeitstunden beruht auf einer hohen Teilzeitquote insbesondere von Frauen. Das Problem läßt sich nur durch bessere Kinderbetreung und Pflege lösen. Es fehlen vor allem Facharbeiter und Pflegekräfte. Bessere Schul- und Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen werden gebraucht! Abgesehen davon: eine 4 Tage-Woche lässt Raum, um die Vernachlässigung der öffentlichen Infrastruktur, zunehmende Hitze und dysfunktionelle Kinder- und Jugendbetreuung zu managen und Ehrenämter wie Mitarbeit bei Vereinen und Gemeindearbeit wahrzunehmen.