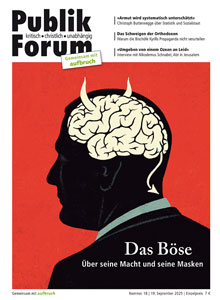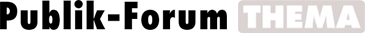Pro und Contra
Wohnungsnot – brauchen wir ein erweitertes Vorkaufsrecht?

Ines Schwerdtner: Ja!
 Der Schock war groß, als das Bundesverwaltungsgericht 2021 das kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten als wohnungspolitisches Instrument der Kommunen aushöhlte und nutzlos machte. Bis dahin stand es den Kommunen als Werkzeug zur Sicherung städtebaulicher Ziele zur Verfügung. So konnten die oft seit Jahrzehnten dort Wohnenden vor Verdrängung durch Umwandlungen in teure Eigentumswohnungen und Luxussanierungen geschützt werden. Mieterinnen und Mieter in Ballungsräumen sehen sich regelmäßig mit steigenden Mieten konfrontiert, wenn ihr Haus verkauft wird. Das ist kein Zufall, sondern oft Folge von Sanierungen oder Umwandlungen, die die Refinanzierung des Kaufs ermöglichen und Investoren fette Gewinne bescheren. Bis zu diesem Urteil konnten die Kommunen mit dem Vorkaufsrecht gegenhalten und so Mietsteigerungen zumindest eindämmen, Verdrängung verhindern und Spekulation bremsen.
Der Schock war groß, als das Bundesverwaltungsgericht 2021 das kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten als wohnungspolitisches Instrument der Kommunen aushöhlte und nutzlos machte. Bis dahin stand es den Kommunen als Werkzeug zur Sicherung städtebaulicher Ziele zur Verfügung. So konnten die oft seit Jahrzehnten dort Wohnenden vor Verdrängung durch Umwandlungen in teure Eigentumswohnungen und Luxussanierungen geschützt werden. Mieterinnen und Mieter in Ballungsräumen sehen sich regelmäßig mit steigenden Mieten konfrontiert, wenn ihr Haus verkauft wird. Das ist kein Zufall, sondern oft Folge von Sanierungen oder Umwandlungen, die die Refinanzierung des Kaufs ermöglichen und Investoren fette Gewinne bescheren. Bis zu diesem Urteil konnten die Kommunen mit dem Vorkaufsrecht gegenhalten und so Mietsteigerungen zumindest eindämmen, Verdrängung verhindern und Spekulation bremsen.
Das Urteil legte fest, dass nur die tatsächlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Verkaufs maßgeblich seien. Künftige Nutzungsszenarien oder städtebauliche Ziele dürfen demnach nicht mehr allein aufgrund ihrer Prognose zur Begründung einer Vorkaufsausübung durch Kommunen gemacht werden. Das war ein schwerer Schlag. Jetzt ist das Instrument nur noch bei baulichen Mängeln oder Missständen anwendbar. Seit fast vier Jahren drängen Mieterinnen- und Mieterinitiativen, Kommunalverbände und Teile der Baubranche auf eine Reaktivierung der Instrumente. Immer wieder versprechen Regierende, das Vorkaufsrecht wiederherzustellen. Auch im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD heißt es, man wolle das »Vorkaufsrecht für Kommunen in Milieuschutzgebieten und bei Schrottimmobilien« stärken. Doch passiert ist nichts.
Die Linke fordert seit Jahren, ein rechtssicheres Vorkaufsrecht neu zu regeln. Die Kommunen müssen es nutzen können, wenn anzunehmen ist, dass künftige Bebauung oder Nutzung dem Ziel der Erhaltungssatzung widersprechen. Zudem müssen städtebauliche Maßnahmen, die den Erhalt der Wohnbevölkerung gefährden, zu einer durch die Kommunen bestimmten Zeit untersagt werden können. Die Zeit drängt, denn in den Ballungsräumen ist Verdrängung durch Luxussanierung an der Tagesordnung. Ich erwarte von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD), dass sie einen solchen Gesetzentwurf vorlegt. Das ist sie den rund 43 Millionen Menschen, die hier in Mietwohnungen leben, schuldig. Wenn wir den Mietenwahnsinn in den Griff kriegen wollen, brauchen wir weitere Maßnahmen: einen Mietendeckel und die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen, die Mieterinnen und Mieter ausplündern.
Kai H. Warnecke: Nein!
 In vielen Ballungsräumen ist die Wohnraumsituation angespannt. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt deutlich das Angebot. Aber die Lage ist nicht überall gleich – auf dem Land gibt es oft Leerstand. Umso fragwürdiger ist die Forderung eines generellen Vorkaufsrechts: Es setzt am falschen Punkt an, schafft neue Probleme und geht an den Ursachen der Engpässe vorbei. Ein Vorkaufsrecht bedeutet, dass private Kaufentscheidungen nachträglich ausgehebelt werden können. Käufer und Verkäufer haben einen Vertrag geschlossen, doch die Kommune tritt dazwischen und übernimmt das Geschäft. Das schwächt die Rechtssicherheit und greift in das Grundrecht auf Eigentum ein.
In vielen Ballungsräumen ist die Wohnraumsituation angespannt. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt deutlich das Angebot. Aber die Lage ist nicht überall gleich – auf dem Land gibt es oft Leerstand. Umso fragwürdiger ist die Forderung eines generellen Vorkaufsrechts: Es setzt am falschen Punkt an, schafft neue Probleme und geht an den Ursachen der Engpässe vorbei. Ein Vorkaufsrecht bedeutet, dass private Kaufentscheidungen nachträglich ausgehebelt werden können. Käufer und Verkäufer haben einen Vertrag geschlossen, doch die Kommune tritt dazwischen und übernimmt das Geschäft. Das schwächt die Rechtssicherheit und greift in das Grundrecht auf Eigentum ein.
In der Praxis geht es dabei häufig gar nicht um echte Käufe durch die Kommune, sondern um sogenannte Abwendungsvereinbarungen. Käufer werden unter dem Druck des drohenden Vorkaufs gezwungen, umfangreiche Auflagen zu akzeptieren – etwa Sanierungsverbote oder Einschränkungen bei Modernisierungen. So entsteht ein Klima der Unsicherheit, das private Investitionen bremst.
Vor allem aber: Durch Vorkäufe und Abwendungsvereinbarungen entstehen keine neuen Wohnungen. Die Zahl bleibt gleich – es wird nur umverteilt, wer Eigentümer ist und was er mit seiner Immobilie darf. Die Ursache der Wohnungsnot liegt im mangelnden Neubau. Hier sind Bürokratieabbau, schnellere Verfahren und verlässliche Bedingungen gefragt, nicht Eingriffe in Kaufverträge.
Hinzu kommt die Kostenfrage. Kommunen müssten Immobilien zu Marktpreisen erwerben. Angesichts knapper Kassen bedeutet das: Jeder Euro für den Kauf von Bestandswohnungen fehlt beim Bau neuer Wohnungen, bei Schulen, Kitas oder Infrastruktur. Es ist ein ineffizienter Mitteleinsatz mit zweifelhaftem Nutzen. Kommunen sind keineswegs der bessere oder gar solventere Eigentümer. Viele städtische Wohnungsunternehmen kämpfen mit Sanierungsstaus und knappen Budgets. Warum sollten Kommunen weitere Bestände übernehmen, die sie kaum effizient bewirtschaften können?
Ein generelles Vorkaufsrecht setzt das falsche Signal. Es schreckt private Investitionen ab, die für den Neubau gebraucht werden. Um den Wohnungsmarkt zu entlasten, muss man den Bau von Wohnungen durch weniger Bürokratie, steuerliche Anreize und eine aktive Bodenpolitik erleichtern. Kooperation zwischen Kommunen und privaten Eigentümern bringt mehr, als wenn die Kommune zur Käuferin in Konkurrenz tritt.
Darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht auf teure und wirkungslose Symbolpolitik.
Ines Schwerdtner ist Mitglied des Bundestags und mit Jan van Aken Vorsitzende der Linkspartei.
Kai H. Warnecke ist Präsident der Interessensgemeinschaft Haus & Grund, die die Anliegen von privaten Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümern vertritt.
Wohnungsnot – brauchen wir ein erweitertes Vorkaufsrecht?