Pro und Contra
Abtreibungen außerhalb des Strafrechts stellen?

Reiner Anselm: Ja!
 Die Kritik am §218 im Strafgesetzbuch (StGB) ist so alt wie der Paragraf selbst. Hier werde das Selbstbestimmungsrecht der Frau über Gebühr eingeschränkt und ihr eine Pflicht auferlegt, die zu formulieren dem Gesetzgeber nicht zukomme. Dass der Abtreibungsparagraf anfänglich eine misogyne Spitze hatte und mehr an der Sozialdisziplinierung der Frau denn am Schutz des Ungeborenen interessiert war, haben Feministinnen schon im Kaiserreich erkannt. Mehrere Reformen später ist davon allerdings nicht mehr viel übrig, das gilt es ausdrücklich anzuerkennen. Heute ist nach erfolgter Beratung der Tatbestand des §218 nicht verwirklicht, so regelt es §218a. Und auch wenn die Beratung dem Leben dienen und darauf hinweisen soll, dass der Abbruch eine Ausnahme darzustellen hat, ist sie ergebnisoffen zu führen. Die Schwangere entscheidet letztlich selbstbestimmt über den Abbruch oder das Austragen der Schwangerschaft.
Die Kritik am §218 im Strafgesetzbuch (StGB) ist so alt wie der Paragraf selbst. Hier werde das Selbstbestimmungsrecht der Frau über Gebühr eingeschränkt und ihr eine Pflicht auferlegt, die zu formulieren dem Gesetzgeber nicht zukomme. Dass der Abtreibungsparagraf anfänglich eine misogyne Spitze hatte und mehr an der Sozialdisziplinierung der Frau denn am Schutz des Ungeborenen interessiert war, haben Feministinnen schon im Kaiserreich erkannt. Mehrere Reformen später ist davon allerdings nicht mehr viel übrig, das gilt es ausdrücklich anzuerkennen. Heute ist nach erfolgter Beratung der Tatbestand des §218 nicht verwirklicht, so regelt es §218a. Und auch wenn die Beratung dem Leben dienen und darauf hinweisen soll, dass der Abbruch eine Ausnahme darzustellen hat, ist sie ergebnisoffen zu führen. Die Schwangere entscheidet letztlich selbstbestimmt über den Abbruch oder das Austragen der Schwangerschaft.
Über die Jahre ist hier ein interessenausgleichendes Regelungsgeflecht entstanden. Es balanciert den rechtlichen Lebensschutz und die Entscheidungsfreiheit der Schwangeren. Die Brücke zwischen dem Lebensrecht des Ungeborenen und dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter bildet die verpflichtende Beratung, hier müssen die Interessen der Mutter, das Recht des Ungeborenen und die Verpflichtungen der Gesellschaft zur Sprache kommen. Hier dürfte auch der effektivste Ort für einen Ausgleich der konkurrierenden Interessen sein.
Führt man sich das vor Augen, stellt sich umso deutlicher die Frage, welche Funktion dem Strafrecht zukommt, solange das gesamte Gewicht des rechtlichen Schutzes auf der ja auch von der EKD befürworteten Pflichtberatung liegt – und zwar strenger als bisher auch bis zur 22. (!) Schwangerschaftswoche. Es liegt auf der Hand: keine substanzielle. Es ist allein der Drang zur Bevormundung der Frau. Ist es also nicht endlich an der Zeit, durch eine Regelung außerhalb des StGB diese unheilige Tradition hinter uns zu lassen und deutlich zum Ausdruck zu bringen: Die Entscheidung liegt bei der Schwangeren, sie muss die Abwägung treffen zwischen dem Lebensrecht des Ungeborenen und ihren Möglichkeiten, Mutter dieses Kindes zu werden.
Gerade weil wir uns als evangelische Kirche vielleicht spät, aber dann doch mit Nachdruck für die volle Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt haben, können wir uns diese vielleicht für Außenstehende eher symbolische, aber für Frauen ungemein wichtige Anerkennung ihrer ethischen Urteilsfähigkeit zu eigen machen. Und zugleich liegt es an der Gesellschaft, immer wieder daran zu erinnern, dass der Lebensschutz unser aller Aufgabe ist. Wir sollten die Frauen unterstützen, nicht bestrafen.
Ernst-Wilhelm Gohl: Nein!
 Das Leben ist Gabe Gottes. »Gottes Annahme des ungeborenen Lebens verleiht ihm menschliche Würde. Daraus folgt die Verpflichtung, dass auch die Menschen das ungeborene Leben annehmen und ihm Schutz gewähren sollen, der der menschlichen Person gebührt.« Diese Grundüberzeugung hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Jahr 2000 gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz formuliert. Die bisherige Regelung des §218 sucht den Ausgleich zwischen zwei Grundrechten, dem Grundrecht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit der Frau und dem Schutz des Lebens. Die Schwangere und das ungeborene Kind haben ihre Rechte. Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist ein Abbruch rechtswidrig, aber straflos, wenn der Beratungspflicht nachgekommen wird. Die geplante Neuregelung dagegen sieht keine Grundrechtskollision. Erst ab der 22. Woche soll das Strafrecht greifen. Denn ab ihr ist nach derzeitigem Stand der Medizin ein Überleben des Kindes außerhalb des Mutterleibes möglich. Ich halte diesen Zeitpunkt für hoch problematisch. Der Embryo ist in einem deutlich fortgeschritteneren Stadium als in der zwölften Woche. Ob das Kind in der 22. Woche außerhalb des Mutterleibes überlebt, hängt nicht von einem Gesetz ab, sondern von der Ausstattung der Klinik. Und was ist mit der Zeit vor der 22. Woche? Das Diskussionspapier der EKD entledigt sich der anthropologischen Grundfrage nach dem Beginn des Lebens mit der lapidaren Bemerkung, es habe sich als »Sackgasse erwiesen, die Frage nach dem Status des Embryos klären zu wollen, ob diesem Würde zukommt oder nicht«. Gerade bei der Lösung grundlegender ethischer Konflikte halte ich, um mit dem ehemaligen Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber zu sprechen, den »willkürärmsten Zeitpunkt« für den tragfähigsten. Jede Skalierung des Lebensbeginns und der Würde, die auch ungeborenem Leben zukommt, hat Auswirkungen auf das grundlegende Verständnis von Leben. Nicht nur in Zeiten, in denen der assistierte Suizid öffentlich gefordert wird, sollten wir als Christinnen und Christen einen anderen Ton in die Debatte hineintragen. Gott ist ein Freund des Lebens. Ohne Not und ohne Befassung der Synode und der Gliedkirchen gibt nun der Rat diese gemeinsame ökumenische Position auf. In bioethischen Debatten, die in unserer Gesellschaft mit zunehmender Polarisierung geführt werden, ist die Ökumene wichtiger denn je. Wenn Positionen der Kirchen zum Beginn und Ende des Lebens als vollständig heterogen wahrgenommen werden, schwächt das die Position der Kirchen und damit auch den Schutz des Lebens – am Lebensanfang und -ende.
Das Leben ist Gabe Gottes. »Gottes Annahme des ungeborenen Lebens verleiht ihm menschliche Würde. Daraus folgt die Verpflichtung, dass auch die Menschen das ungeborene Leben annehmen und ihm Schutz gewähren sollen, der der menschlichen Person gebührt.« Diese Grundüberzeugung hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Jahr 2000 gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz formuliert. Die bisherige Regelung des §218 sucht den Ausgleich zwischen zwei Grundrechten, dem Grundrecht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit der Frau und dem Schutz des Lebens. Die Schwangere und das ungeborene Kind haben ihre Rechte. Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist ein Abbruch rechtswidrig, aber straflos, wenn der Beratungspflicht nachgekommen wird. Die geplante Neuregelung dagegen sieht keine Grundrechtskollision. Erst ab der 22. Woche soll das Strafrecht greifen. Denn ab ihr ist nach derzeitigem Stand der Medizin ein Überleben des Kindes außerhalb des Mutterleibes möglich. Ich halte diesen Zeitpunkt für hoch problematisch. Der Embryo ist in einem deutlich fortgeschritteneren Stadium als in der zwölften Woche. Ob das Kind in der 22. Woche außerhalb des Mutterleibes überlebt, hängt nicht von einem Gesetz ab, sondern von der Ausstattung der Klinik. Und was ist mit der Zeit vor der 22. Woche? Das Diskussionspapier der EKD entledigt sich der anthropologischen Grundfrage nach dem Beginn des Lebens mit der lapidaren Bemerkung, es habe sich als »Sackgasse erwiesen, die Frage nach dem Status des Embryos klären zu wollen, ob diesem Würde zukommt oder nicht«. Gerade bei der Lösung grundlegender ethischer Konflikte halte ich, um mit dem ehemaligen Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber zu sprechen, den »willkürärmsten Zeitpunkt« für den tragfähigsten. Jede Skalierung des Lebensbeginns und der Würde, die auch ungeborenem Leben zukommt, hat Auswirkungen auf das grundlegende Verständnis von Leben. Nicht nur in Zeiten, in denen der assistierte Suizid öffentlich gefordert wird, sollten wir als Christinnen und Christen einen anderen Ton in die Debatte hineintragen. Gott ist ein Freund des Lebens. Ohne Not und ohne Befassung der Synode und der Gliedkirchen gibt nun der Rat diese gemeinsame ökumenische Position auf. In bioethischen Debatten, die in unserer Gesellschaft mit zunehmender Polarisierung geführt werden, ist die Ökumene wichtiger denn je. Wenn Positionen der Kirchen zum Beginn und Ende des Lebens als vollständig heterogen wahrgenommen werden, schwächt das die Position der Kirchen und damit auch den Schutz des Lebens – am Lebensanfang und -ende.
Reiner Anselm ist Mitglied im Steuerungsbord des Kammernetzwerks der EKD und Professor für Systematische Theologie und Ethik in München.
Ernst-Wilhelm Gohl ist Landesbischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Abtreibungen außerhalb des Strafrechts stellen?



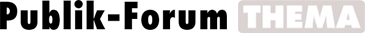

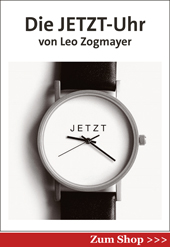

Petra Marzinzig 12.01.2024:
Zuallererst fällt mal wieder auf: Es sind zwei Männer, die hier Stellung nehmen pro oder contra. Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein Friseurbesuch, es ist ein körperlicher und seelischer Eingriff im Leben einer Frau. Meist begleitet dieser Eingriff die Frauen ein ganzes Leben lang. Wer glaubt eigentlich, dass diese Entscheidung einfach mal so, zwischen Frühstück und Kaffeetrinken, getroffen wird? Ich empfinde diese ganze Diskussion als anmaßend.
Inken Behrmann 12.01.2024:
Als Frau bin ich vollwertige Bürgerin dieses Landes, kann wählen, arbeiten, Steuern bezahlen und mich einbringen. Das alles wird mir zugetraut und dazu bin ich sogar verpflichtet. Nur, dass ich eine sinnvolle und ausgewogene Entscheidung über meinen eigenen Körper treffen kann, scheint immer noch fragwürdig. Ich finde, das ist eine patriarchale Anmaßung. Nicht zuletzt gibt es zunehmend das Problem, dass es bei immer weniger Ärztinnen und Ärzten, die abtreiben, mit der Beratung und allen Fristen zeitlich knapp wird, den Schwangerschaftsabbruch im gesetzlichen Rahmen durchzuführen – praktische Probleme, mit denen sich Herr Gohl sicher nicht befassen muss.
Waldemar Hirsch 12.01.2024:
Ich schließe mich der Kritik an, dass sich zu dieser wahrlich lebenswichtigen Frage keine weibliche Stimme geäußert hat. Männer sind bekanntlich von dieser Problematik immer nur mittelbar betroffen. Nun liegen beide Stellungnahmen nicht weit auseinander. Mein Landesbischof hat mich allerdings mit seinen Argumenten nicht davon überzeugen können, dass der Schwangerschaftsabbruch etwas im Strafrecht verloren hat. Heute wäre es notwendiger denn je, die sozialen und gesellschaftlichen Begleitumstände so zu verändern, dass sich die Zahl der Frauen, die vor einer so schwerwiegenden Entscheidung stehen, auf ein Minimum reduziert. Hier vor allem sind die Kirchen gefordert.
Elke Kügler 12.01.2024:
Wer sich dagegenstellt, dass eine Frau allein über das Austragen einer Schwangerschaft entscheiden soll, ist blind, frauenfeindlich oder ungebildet oder alles zusammen. Es beginnt schon bei der Terminologie. Das »ungeborene Leben« ist eine Erfindung der (katholischen) Kirche im letzten Jahrhundert, welche bekanntermaßen von Frauen wenig hält. Eine Leibesfrucht heißt entweder Embryo, ab dem dritten/vierten Monat Fötus und erst nach der Geburt Kind. Bezeichnet eine Schwangere ihre Leibesfrucht als »Kind«, wird sie niemals abtreiben, weil die Bezeichnung auf eine enge emotionale Beziehung sogar zu einem Zellhaufen deutet. Dieser Zustand ist häufig; es gibt nämlich auch Frauen, die sich auf/über eine Schwangerschaft freuen. Möchte eine Frau ihre Leibesfrucht nicht und unterlässt eine Abtreibung, ist das geborene Kind nicht zu beneiden. Wer sich sehenden Auges umsieht, kann feststellen, dass es viele ungeliebte, ungewollte – das ist nicht grundsätzlich dasselbe – Kinder gibt, die vernachlässigt, misshandelt, getötet werden. Ich kenne mich im Bereich Kinderpornografie gut aus (wie bekanntermaßen ja auch Teile der Kirchen). Es ist gerade in dem ungehemmten Kapitalismus, den wir erleben, beckmesserisch, zu erwarten, dass sich die Umwelt zugunsten von Kindern ändert.
Waldemar Hirsch 06.12.2023, 17:54 Uhr:
Ich schließe mich der Kritik an, dass sich zu dieser wahrlich lebenswichtigen Frage keine weibliche Stimme geäußert hat. Männer sind bekanntlich von dieser Problematik immer nur mittelbar betroffen.
Nun liegen beide Stellungnahmen nicht weit auseinander. Mein Landesbischof hat mich allerdings mit seinen Argumenten nicht davon überzeugen können, dass die Schwangerschaftsunterbrechung etwas im Strafrecht verloren hat. Warum das vor langer Zeit dort mal eingefügt wurde, ist in den anderen Kommentaren dargelegt worden. Heute wäre es notwendiger denn je, die sozialen und gesellschaftlichen Begleitumstände so zu verändern, dass sich die Zahl der Frauen, die vor einer so schwerwiegenden Entscheidung stehen, auf ein Minimum reduziert. Hier vor allem sind die Kirchen gefordert.
Christian Nowottny 05.12.2023, 15:59 Uhr:
Wenn die Mutter das Kind nicht will, muss es zwingend der Vater nehmen.
Georg Lechner 01.12.2023, 18:51 Uhr:
Wenn Lebensschutz unser aller Aufgabe ist, dann haben wir kläglich versagt, weil wir die Verantwortlichen für die völkerrechtswidrigen Kriege 1999 und 2003 (die die Türöffner für alle weiteren Kriege des 21. Jahrhunderts waren) nicht zur Rechenschaft gezogen haben.
Den Satz "Das Leben ist Gabe Gottes" halte ich für hoch problematisch, da er ein Eingreifen einer (unbeweisbaren) außerirdischen Intelligenz in irdische Abläufe nahelegt und so den Spott Feuerbachs provoziert, dass Gott eine menschliche Erfindung ist (in diesem Fall, um patriarchal basierende Machtverhältnisse im Interesse zur Züchtung von Kanonenfutter metaphysisch zu legitimieren).
Inken Behrmann 01.12.2023, 14:29 Uhr:
Als Frau bin ich vollwertige Bürgerin dieses Landes, kann wählen, arbeiten, Steuern bezahlen und mich einbringen. Das alles wird mir zugetraut und dazu bin ich sogar verpflichtet. Nur, dass ich eine sinnvolle und ausgewogene Entscheidung über meinen eigenen Körper treffen kann, scheint immer noch fragwürdig. Ich finde das ist eine patriarchale Anmaßung - und ehrlich gesagt fühlt es sich für mich auch aberwitzig an, dass das Thema hier ausgerechnet zwei Männer diskutieren, die niemals in die Situation kommen könnten, ein Kind austragen zu müssen, mit dem sie nicht schwanger sein wollen.
Nicht zuletzt gibt es zunehmend das Problem, dass es bei immer weniger Ärzt*innen, die abtreiben, der Beratung und allen Fristen zeitlich knapp wird, den Schwangerschaftsabbruch im gesetzlichen Rahmen durchzuführen - praktische Probleme, mit denen sich Herr Gohl sicher nicht befassen muss.
Martin Birkhäuser 30.11.2023, 16:10 Uhr:
Reiner Anselm zieht - für mich überraschend - in seinem Statement nicht die logische Konsequenz aus seiner richtigen Feststellung: "Die Brücke zwischen dem Lebensrecht des Ungeborenen und dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter bildet die verpflichtende Beratung." Eine Verpflichtung zur Beratung kann es ja nur geben, wenn ihre Verweigerung sanktioniert wird. Ohne die Verankerung im Strafgesetz wäre die Inanspruchnahme der Beratung allein der Entscheidung der Mutter überlassen. Die Anwaltschaft für das Kind, die die Beratung - wenn auch ergebnisoffen - schließlich darstellt, wäre somit ausgehebelt weil nicht mehr gewährleistet. Das ist der Grund, weshalb eine ethisch verantwortbare Abwägung zwischen dem Lebensrecht des Kindes und dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter in letzter Konsequenz nicht ohne eine Verankerung des Paragraphen im Strafrecht nicht möglich ist.