EDITORIAL: Der Synodale Weg. Jetzt ist Mut gefragt
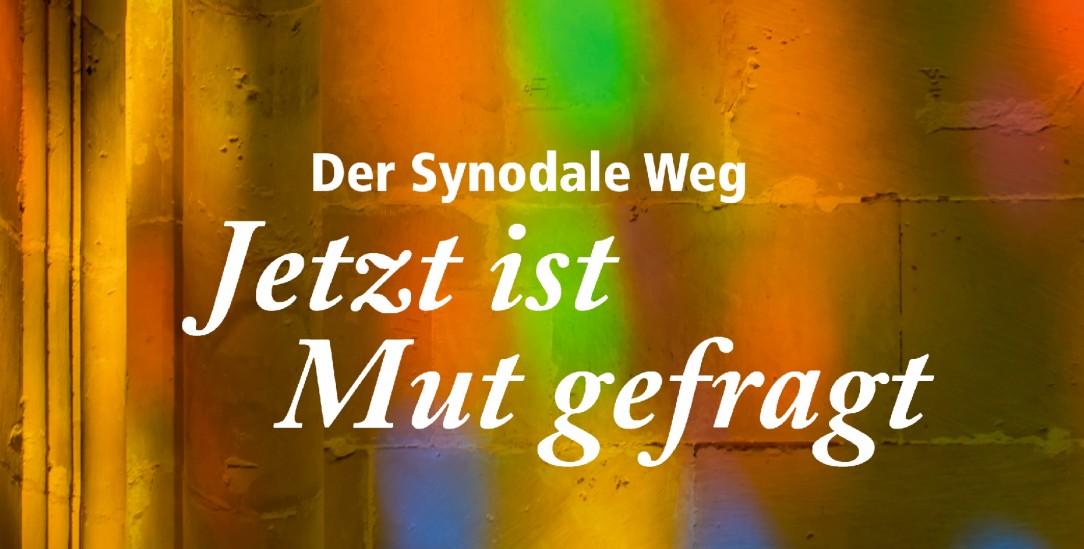
auch wenn man es kaum glauben mag: Veränderung und Reformen gehören zur Kirche wie das Amen nach dem Gebet. Dass es trotzdem fast fünfzig Jahre gedauert hat, bis nach der »Würzburger Synode« wieder ein nennenswerter groß angelegter innerkatholischer Gesprächsprozess zwischen Laien und Bischöfen in Deutschland zustande kommt, zeigt vor allem, welche Macht die kirchlichen Reformverweigerer haben. Auch beim Synodalen Weg, der Ende Januar in Frankfurt am Main beginnt, ist nicht auszuschließen, dass am Ende wieder diejenigen obsiegen, die sagen, dass Jesus Christus die Kirche genau so gewollt hat, wie sie heute ist: mit dem Papst als absolutem Monarchen, mit den Bischöfen als Statthaltern, mit dem Zölibat für die Priester und mit der »klassischen« Rollenverteilung von Mann und Frau. Der emeritierte Papst Benedikt XVI., der eigentlich schweigen und beten wollte, hat sich – wieder einmal – zu Wort gemeldet und Papst Franziskus öffentlich vor einschneidenden Reformen gewarnt.
Das aber zeigt uns, wie notwendig es ist, dass in Publik-Forum all jene zu Wort kommen können, die sich mit dem selbstgefälligen Immer-Weiter-So und den vermeintlich ewigen Wahrheiten nicht abfinden wollen. Wir fühlen uns den kirchlichen Reformkräften von »unten« und von »oben« verbunden. Nicht nur, weil Publik-Forum selbst aus einer geistigen Protestbewegung heraus entstanden ist, sondern auch aus einem theologischen Grund: Wenn Gott sich in Jesus Christus auf die Geschichte eingelassen hat, dann gilt das Prinzip der Geschichtlichkeit auch für die Kirche.

In diesem Dossier vertiefen wir die Themen der vier synodalen Gesprächsforen: Die Kirchenrechtlerin Sabine Demel zeigt, wie leicht sich das Machtgefälle zwischen Klerikern und Laien verringern ließe, wenn man nur wollte (Seite 10). Die Essener Theologin Andrea Qualbrink, die ein Aufstiegsprogramm für Frauen in der Kirche mitverantwortet, erklärt im Interview, wie sich Frauen in kirchlichen Leitungsämtern fühlen und was sie berücksichtigen müssen, wenn sie ein solches anstreben (Seite 8). Die Philosophin Anne Weber beschreibt, welchen Fragen sich eine christliche Sexualethik zuwenden müsste, um relevant zu werden (Seite 11). Und der Dortmunder Theologe Thomas Ruster unterbreitet einen revolutionären, aber biblisch fundierten Vorschlag für ein neues Amtsverständnis des Priesters (Seite 12).
Unsere Bitte: Vernetzen Sie sich mit jenen, die sich für eine Erneuerung in der Kirche einsetzen. Das Dossier bietet eine gute Grundlage für Diskussionsrunden in der Pfarrei, an der Universität oder in der Erwachsenenbildung. So kann der Synodale Weg Dynamik entwickeln und in die Tiefe wirken. Eine anregende Lektüre wünscht
Michael Schrom



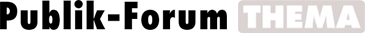
 Synodaler Weg
Synodaler Weg
