Religion im Säkularismus
Fehlt da was?

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Wer ein Monopol innehat, kann laut Definition sicher sein, der einzige Anbieter für ein von allen nachgefragtes Produkt zu sein. Mit diesem Bild kann man vielleicht – bei aller Begrenzung eines Metapherntransfers zwischen Ökonomie und Religion – auch die derzeitige Transformation des Christentums verstehen. War lange klar, dass Religion und Kirche unbedingt zu einem geglückten und sinnerfüllten Leben dazugehören, ist genau dieses Monopol heute brüchig. Einmal sagen zunehmend viele Menschen, sie seien glücklich, auch ohne religiös zu sein; in den am meisten säkularisierten Ländern leben laut Umfragen sogar die glücklichsten Menschen. Zugleich gibt es andere Anbieter, die Glück und Sinn mindestens ebenso erfolgreich vermitteln.
Solcher Monopolverlust wird schmerzlich erlebt: als Verlust an Relevan
Jan Loffeld ist Professor für Praktische Theologie an der Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht. Sein Buch »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt« (Herder) ist im Publik-Forum Shop unter der Best.-Nr. 18656 erhältlich.



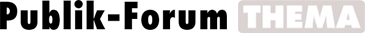
Thomas Bartsch-Hauschild 17.08.2025, 10:47 Uhr:
Monopolismus - das ist die Summe -der Glaube jedes einzelnen,kein Wettbewerb und Konkurenz zur Wirtschaft von Konzernmacht.
Die Institution Kirche ist öffentlicher Raum und Ort von Gemeinschaft.
Jeder Mensch allein entscheidet was er glaubt oder nicht-das ist garantierte Freiheit des Geistes.
Mario Crola 08.08.2025:
Im Beitrag von Jan Loffeld stelle ich fest, dass da etwas fehlt. Nämlich eine Antwort auf die Frage, ob es der Kirche gelingt, so von Gott zu reden, dass der potenzielle Freiheitsgewinn des Glaubens deutlich wird? Es fehlt die Hoffnung in einer Sprache, die diese potenzielle Freiheit offenkundig machen kann, mit der nicht sakrifiziellen Deutung des Evangeliums, wie es im Buch »Das Ende der Gewalt« von René Girard beschrieben wird.
Wolfgang Zopora 08.08.2025:
Am Ende des Artikels bin ich genauso schlau wie vorher. Es bedarf auf der einen Seite einer grundlegenden »Analyse«, was Kirche in Deutschland sein soll oder kann oder will. Es braucht aber noch viel mehr die Besinnung auf den Ursprung der
Kirche. Für mich (und für die letzten
Päpste) ist es die Verkündigung der Frohen Botschaft über Jesus, den auferstandenen Herrn. Das fehlt mir in der »allumfassenden Analyse« sehr beziehungsweise es wird zu wenig in den Vordergrund gestellt.
Nur die Botschaft des Evangeliums ist das Fundament der christlichen Kirchen. »Wenn ich an die Auferstehung nicht glaube, dann ist mein Glaube nichts!«, so kann man es im Römerbrief sehr deutlich nachlesen.
Joachim Kothe 08.08.2025:
In Deutschland, einem ziemlich »säkularisierten Land«, findet sich bei Jungen und jungen Männern eine recht hohe Gewaltbereitschaft an Schulen, bei Mädchen und jungen Frauen ein einigermaßen hoher Prozentsatz an stilleren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Magersucht. Depressionen werden oft verschwiegen, treten aber auch recht häufig auf. Die Wartelisten der psychiatrisch/psychologisch ausgerichteten Kliniken sind lang. Es gibt einen »Rechtsruck« in der Gesellschaft, oft gespeist aus »Unzufriedenheit«, die Tendenz ist bemerkenswert. Mitgefühl gegenüber Flüchtlingen und Migranten nimmt anscheinend ab. Spricht das für eine Gesellschaft mit »hohem Glücksgefühl?«
Paul-Gerhardt Künzel 24.07.2025, 09:09 Uhr:
"Die vollen Körbe der 50er Jahre": Sehr gut beschreibt diese Metapher die finanzielle Ausstattung der Kirchen, vielleicht auch durch die Kollektenkörbe, die sich in bestens besuchten Gottesdiensten füllten. Für die Bundesrepublik gilt das in besonderem Maße. Der Wiederaufbau nach dem Krieg, die sichtbaren Erfolge eigener Anstrengung und das Vertrauen auf das, was die Kirchen als individuelles Heil predigten, passten zu einander.
Und im Osten? Mein Taufspruch, der mir im August 1958 in Leipzig gegeben wurde, deutet eine ganz andere Situation an: "Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt."
Ein solches Grundvertrauen kam dem Anliegen Jesu viel näher. Und es hat auch dazu beigetragen, dass das System überwunden wurde: Mutig, stark beherzt. Das westliche System hat gesiegt. Aber nichts begriffen.
Ich sehe jetzt neue spirituelle Aufbrüche unter Christen.
Georg Lechner 08.07.2025, 13:02 Uhr:
"Der Glaube sei ein Gegengift zu Allmachtsfantasien, ein Platzhalter für die menschliche Begrenztheit, der an die Demut als eine für heute notwendige Tugend erinnert." Die Allmachtsfantasien hängen eng mit der Verkündigung eines allmächtigen (und personal statt geistig gedachten) Gottes zusammen. Wie Horst-Eberhard Richter in "Der Gotteskomplex" gezeigt hat, hat sich daran die erste Säkularisierungswelle (zu Beginn der Neuzeit) gerieben. Diese Verkündigung ist in den Festlegungen des Konzils von Nicäa (siehe PuFo 12/2025) grundgelegt und erweist sich immer mehr als kontraproduktiv: Dogmen werden zunehmend als auf Papier gebannte Irrtümer gesehen; wer nicht religiös sozialisiert ist (im Sinne der zitierten Textpassage), erwartet in der Regel nichts mehr von den Kirchen.