Ein Prediger gegen die Angst

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Thomas de Maizière, Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentags, darf sich bestätigt fühlen – und er genießt diesen Moment sichtlich. Die Westfalenhalle ist sehr gut gefüllt, und das, obwohl es sich um ein »Dinosaurierformat« handelt: Ein langer Vortrag mit Möglichkeit zum Nachfragen. Keine kontroverse Talkshow, kein Expertengespräch, kein World-Cafe, keine filmischen Einspielungen oder Powerpointfolien. Volle Konzentration auf das Wort. Eigentlich eine Zumutung angesichts heutiger Möglichkeit. Er habe für dieses Format gekämpft, sagt de Maizière. Das Risiko hat sich gelohnt.
Heribert Prantl, ehemals Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, erweist sich als mitreißender Prediger gegen die Angst. Dass er eine Affinität



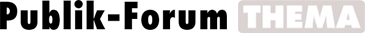

Andreas Bartholomé 25.06.2019:
Lese ich einen der Kommentare von Heribert Prantl, so weiß ich wieder warum ich noch Christ bin. Er kämpft mit Leidenschaft, Verstand und großartiger Sprache für die Ziele Christi. Diese Rede von ihm rüttelt auf.
A. Bringt 22.06.2019:
Es wäre schön, wenn Sie diesen Vortrag in Publik-Forum einem breiteren Publikum zugänglich machen könnten.