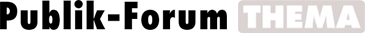Roman: Ian McEwan
Eine grandios erzählte Ode an die Kraft der Literatur

Roman. Wir schreiben das Jahr 2119. Etliche Jahrzehnte voller Kriege, Tsunamis und nuklearer Explosionen haben weite Bereiche einstigen Festlands unterm Meeresspiegel versinken lassen. Die Reste der Zivilisation sind auf Inseln verstreut, die aus den Fluten emporragen. Diese Zukunft entwirft der englische Schriftsteller Ian McEwan in seinem neuen Roman »Was wir wissen können«. Erstaunlicherweise existieren in dieser Zukunft auch noch geisteswissenschaftliche Fakultäten und Forschende, die sich für vergangene Zeiten und deren Sonette interessieren. So zum Beispiel Thomas Metcalfe und Rose Church. Thomas, aus dessen Perspektive gut die erste Hälfte des Buchs erzählt wird, bedauert den Verlust früheren kulturellen Reichtums, Rose betont eher die Dummheit derer, die sehend in die Katastrophe zogen. Begeistert, geradezu besessen ist Thomas von dem berühmten Gedichtzyklus eines (fiktiven) Dichters, das der Nachwelt nicht erhalten ist und dennoch einen Generationen übergreifenden Kult ausgelöst hat. Wenn er nun doch – so träumt der Forscher des 22. Jahrhunderts – noch eine Abschrift aufstöbern könnte?
Was sich nun anschließt, ist ein unglaublich spannender, unterhaltsamer und intelligenter Mix aus Intellektuellenroman, Schatzsuche, Liebes-, Betrugs- und Kriminalgeschichte. Dass man aus der fiktiven Suche nach einem fiktiven Gedicht einen so fesselnden Roman stricken kann – unwahrscheinlich. Aber McEwan, diesem grandiosen Erzähler, gelingt es. Wenn man am Ende, noch atemlos, das Buch zuschlägt, schwirrt einem vielleicht kurz die Frage durch den Kopf: Habe ich jetzt wesentlich Neues über die Menschen, den Klimawandel oder die Zukunft gelernt? Vermutlich nicht. Aber das verzeiht man so einem famosen Roman gern.
Ian Mac Ewan: Was wir wissen können.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben.
Diogenes. 480 Seiten. 28 €