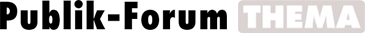Zum Tee bei Comte …
Der Geschmähte
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Monsieur Comte, Sie gelten derzeit in Deutschland als eine Art »Wiederentdeckung« – während sie in Frankreich und England eigentlich kontinuierlich hohes philosophisches Ansehen genossen. Die Wiederentdeckung bezieht sich darauf, dass man Sie als Begründer beziehungsweise wichtigen Wegbereiter der modernen Soziologie interpretiert. Darüber möchte ich gern mit Ihnen sprechen, aber auch erörtern, warum sie lange als »Positivist« mehr geschmäht als gefeiert wurden. Was versteht man eigentlich unter »Positivismus«?
Auguste Comte: Der Positivismus folgt der Auffassung, nur jene wissenschaftlichen Aussagen für seriös zu halten, die auf Beobachtungen beruhen. Positivisten räumen der Beobachtung einen sehr hohen Stellenwert ein und haben eine Tendenz, Spekulationen und abstrakte Hyp
Dagmar Borchers ist
Professorin für angewandte
Philosophie an der Universität Bremen. Sie publiziert zu
Fragen der Ethik (unter anderem Tierethik, Medizinethik und Bioethik, Kritik der Tugendethik) und der Politischen
Philosophie.
Auguste Comte (1798-1857) war ein französischer Mathematiker, Philosoph und Religionskritiker. Bekannt ist er als Begründer des Positivismus und Mitbegründer der Soziologie. In Paris bestritt er seinen Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten, unter anderem als Privatlehrer für Mathematik. 1822 veröffentlichte Comte sein grundlegendes Werk der Philosophie des Positivismus, doch ein Lehrstuhl blieb ihm versagt. Selbst eine bescheidene Stelle als Mathematik-Repetitor verlor er später wegen seiner strittigen Schriften. Sein Lebensunterhalt hing von finanzieller Hilfe seiner Freunde ab. Kritiker sahen in seinen Bestrebungen einen »gottlosen Katholizismus«.