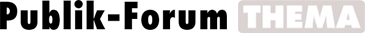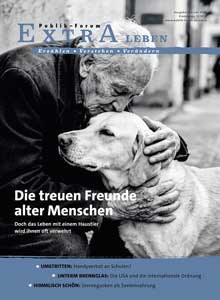Stuhl Nr . 14
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Die Geschichte des Sitzens ist auch eine Geschichte der Demokratisierung, vom sakralen Thron für den einen zu den profanen Stühlen für alle. Im Mythos ist der privilegiert Sitzende zum einen die Verbindung zur übermenschlich-göttlichen Sphäre; damit gewährleistet er für die Gemeinschaft Mitte und Orientierung. Denn als die Menschen sesshaft wurden und im Bau eines Hauses ein Stück Erde mit Dach und Mauern ummantelten, verkleinerten sie den überwältigenden Kosmos auf ein menschliches Maß, kappten aber zugleich die Verbindung nach oben zu den kosmischen Mächten. Diesen Frevel galt es, mit einem Opfer zu sühnen. Deswegen wurde einer auf den Thron gesetzt. Zum Stillsitzen erkoren, richtete der Geweihte seine Energien nach innen. Während die anderen ihre Lebensenergie verausgaben, in der Außenwelt wirken lassen, wendet sich der Gesetzte seinen Gedanken und Gefühlen zu. In dieser Verinnerlichung wird er zum geistigen Wesen und Medium, das stellvertretend für die Gemeinschaft den Kontakt zum Göttlichen hält. Man nannte ihn König, Schamane, Medizinmann, er war auch Psychologe und der erste Intellektuelle. Zum anderen ist der Thronende der Hüter des Schöpferischen. Denn der Thron ahmt die Haltung von Fruchtbarkeitsgöttinnen nach, wie sie zum Beispiel als Tonfiguren aus dem prähistorischen Anatolien gefunden wurden: Sie sitzen auf ihrem voluminösen Gesäß auf dem Boden und sind Gebärende. Aus dem siebten vorchristlichen Jahrhundert datiert eine griechische Vase, auf der Zeus auf einem Stuhl sitzend Athene aus seinem Kopf gebiert, während sich unter seiner Sitzfläche Metis aufhält. Sie ist jene Göttin, mit der Zeus Athene zeugte, sie dann aber verschlang. Der Raum unter dem Stuhl ist also ein symbolischer Raum des Schöpferischen. Mit dem Christentum wurde das Sitzen in Europa in einem jahrhundertelangen Prozess etabliert. Ab dem 4. Jahrhundert wird Christus als König auf dem römischen Kaiserstuhl, der sella curulis, sitzend dargestellt. Daraus entwickelte sich der Thron des Papstes. Danach dürfen Bischöfe und Priester sitzen. Im 9. Jahrhundert entwickeln Mönche das Chorgestühl mit seinen Klappstühlen, um der Regel des heiligen Benedikts gemäß an einem Ort stehen, knien und sitzen zu können. Waren bis dahin Stühle immer geweihte Objekte und Zeichen göttlicher Macht, bekommen ab dem 14. Jahrhundert vornehme und reiche Patrizier das Recht, auf einem profanen Stuhl in den Kirchen zu sitzen. Mit dem Protestantismus setzt sich die allgemeine Kirchenbestuhlung durch, und in einem drei Jahrhunderte dauernden Prozess seit 1500 nehmen sich die Bürger nach und nach das Recht heraus zu sitzen. In der Französischen Revolution wird nicht nur der Hauptthron Europas weggeräumt, sondern auch das Sitzprivileg aufgehoben: Von nun an darf jeder sitzen. Allein, es gibt zu dieser Zeit kaum Stühle. Die allermeisten Menschen leben noch wie in der Antike und im Mittelalter ohne Stuhl. Erst mit der Erfindung der Holzbiegetechnik durch den Bopparder Tischlermeister Michael Thonet Mitte des
19. Jahrhunderts wird der Weg frei für die industrielle
Massenfertigung relativ preiswerter und stabiler Stühle: Der Wiener Kaffeehausstuhl Nr. 14 erobert die Welt. Aus dem herausgehobenen Thron, der ein Medium des Sakralen war, ist die profane Massenware Stuhl geworden, die prinzipiell allen Menschen zur Verfügung steht.