Theologie
Die Mechanik der Vergebung

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Wenn man bereue, bekenne und wiedergutmache, bekomme man seine Sünden vergeben. Diese drei Elemente der Beichte seien doch bekannt unter Katholikinnen und Katholiken, so der Jesuit Hans Zollner kürzlich bei einer Tagung über Missbrauch im Raum der Kirche. Deswegen fragte Zollner, warum es für die Kirche als Institution so schwer sei, »ehrlich zu bereuen, was an Verbrechen geschehen ist, öffentlich zu bekennen und dann entsprechend wiedergutzumachen, soweit es möglich ist«. Für Hans Zollner, Präsident des Zentrums für Kinderschutz an der Gregoriana, geht es darum, die alte Lehre von Schuld und Vergebung angesichts der zahlreichen Missbrauchsfälle konsequent umzusetzen. Die Kirche habe im Prinzip den richtigen theologischen Kompass dafür. Ist das so? Oder ist die Lehre von Sünde und Vergebung ein Teil des Problems, warum
Sünde, Schuld und Vergebung aus Sicht evangelischer Anthropologie. Ein Grundlagentext des Rates der EKD. Leipzig 2020. 136 Seiten. pdf unter: www.ekd.de



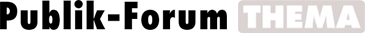
Georg Lechner 16.12.2020, 08:34 Uhr:
Letztlich führt es wieder zur Problematik: Personales oder apersonales Gottesverständnis?
Ein personales Gottesverständnis ist mit der Frage nach dem gnädigen Gott gekoppelt und hat zu den Überlegungen in der abendländischen Geistesgeschichte geführt, die Horst-Eberhard Richter in "Der Gotteskomplex treffend analysiert (und als Trotzreaktion kritisiert) hat.
Ein apersonales Gottesverständnis berücksichtigt die Aussage des Evangelisten Johannes ungleich besser, dass Gott Geist ist und daher nur im Geist und in der Wahrheit recht angebetet werden kann. Ein derart rechtes Anbeten sehe ich in der biblischen Forderung nach Umkehr und Reue ("Gehorsam will ich, nicht Opfer") oder neuzeitlich in der Berücksichtigung der "Freiheit der Geringsten in der Gemeinschaft aller" (in Anlehnung an Hugo Ball) angesprochen.