Ach, Mama
Ein fiktiver Dialog mit meiner verstorbenen Mutter
Marie, meine Mutter, ist seit fast 30 Jahren tot, mein Vater Johann lebt seit über 40 Jahren nicht mehr. Gut, dass sie das nicht mehr erleben mussten, war mein erster Gedanke, als vor fast drei Monaten die Informationen über das Ausmaß der Gesundheitskrise immer dichter über uns hereinbrachen, und mit ihnen allerlei Beschränkungen und Regeln, vor allem aber Angst und Unsicherheit, was denn jetzt werden würde. Marie und Johann haben zwei Kriege erlebt, den 1. Weltkrieg noch als Kinder, zwei Wirtschaftskrisen und eine verbrecherische Diktatur, und immer wieder Armut, Arbeitslosigkeit, Hunger, Krankheit und Tod.
Gerne würde ich jetzt meine Mutter fragen, was sie sagen würde, wenn sie noch am Leben wäre. Ich versuche es herauszufinden.
1. Pandemie
Seit Wochen geht eine bisher unbekannte Krankheit um die ganze Welt, eine Art schwerer Lungenentzündung. Es gibt keine Heilung und keinen Impfstoff, und viele Menschen sterben, in Italien und Spanien, unseren unmittelbaren Nachbarländern – nicht – wie wir es »gewohnt sind« – in Afrika oder Asien, wo das Virus offenbar herkommt. So etwas hat es noch nie gegeben, seit ich lebe!
Du würdest mir vielleicht als erstes erzählen, dass dein Vater, mein Großvater, den ich nicht mehr kennengelernt habe, ja auch an einer schweren Lungenentzündung gestorben ist: Kurz vor Weihnachten 1944 ist das gewesen, der Nachbar hat ihn mit dem Pferdefuhrwerk seiner Brauerei ins Lazarett gefahren, das heutige Servatius-Altenstift in Augsburg. Aber die wenigen Medikamente, die es dort gab, bekamen nur die Soldaten. Dein Vater war keine 60 Jahre alt, und das »Eiserne Kreuz« aus dem 1.Weltkrieg hat ihm offenbar nichts genützt. Ob Johann, dein Mann, Fronturlaub bekommen hat, zur Beerdigung deines Vaters? Vielleicht auch, weil Weihnachten war?
Aber dass du selber 82 geworden bist, das sei doch ein »schönes Alter«, würdest du dann vielleicht sagen! Niemand in unserer Familie ist vorher so alt geworden: deine Mutter starb mit 74, als ich gerade in die Schule gekommen war, und wurde von dir ein paar Jahre lang aufopfernd gepflegt. Johann, mein Vater, starb mit 70 an den Folgen eines Schlaganfalls, da war ich gerade mit dem Studium fertig. Dein Bruder wurde knapp 50, Vaters jüngster Bruder ist Ende April 1945 im Krieg geblieben, und Johanns Eltern fielen dem Bombenangriff auf Augsburg im Februar 1944 zum Opfer.
Als Kind war ich oft auf dem Friedhof, an deiner Hand, Mama. Zuhause habe ich dann meine Puppen in Schuhkartos unterm Wohnzimmertisch beerdigt.
2. Daheim bleiben
Stell dir vor, wir können nicht ausgehen, Mama, würde ich dann erzählen, vor allem wir Älteren sollen zuhause bleiben, weil wir besonders gefährdet seien. Nur wer unbedingt in der Firma arbeiten muss, geht aus dem Haus, viele arbeiten vom Computer aus daheim. Die meisten Geschäfte mussten schließen. Die Einkäufe macht uns eine jüngere Freundin. Das Lebensmittelgeschäft deiner Eltern hätte offen bleiben dürfen!
Das ist ja schön, dass ihr da jemanden habt, würdest du sagen. Als ich älter wurde und mir manches zu viel wurde, hätte ich auch gerne jemanden gehabt, der für mich einkauft. Der Nachbar hat immerhin den Rasen gemäht. Und spazierengehen dürft ihr ja, sagst du. Jetzt, wo ihr Rentner seid, du und dein Mann, habt ihr ja auch die Zeit dazu! Das ist doch schön.
3. Kulturlos
Ja, aber: unser Opernabo bei der Volksbühne ist verfallen, Verdis Rigoletto in Stuttgart! Und auch die Karten für ein Konzert, die wir schon gebucht hatten. Kein Mensch weiß, ob und wann wir sie einmal einlösen können. Und das Sommertheater auf der Neckarinsel, auf das ich mich so gefreut hatte, weil ich im Laienchor mitsingen wollte – alle Proben sind ausgefallen.
Du würdest verständnisvoll nicken und lächeln: Ja, die Oper und das Theater, das kann ich verstehen, dass dir das leid tut! Das war ja einmal dein Leben! Erinnerst du dich an deine Auftritte als Statistin und Chorsängerin auf der Augsburger Freilichtbühne, als junges Mädchen?
Diese Leidenschaft hast du von mir, da bin ich sicher. Habe ich dir nicht immer beim Kochen und Abwaschen die Arien aus Opern und Operetten vorgesungen, und gesummt, wenn uns der Text nicht mehr eingefallen ist? Erinnerst du dich? »Immer nur lächeln, und immer vergnügt, immer zufrieden, was immer geschieht, lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen, und niemals zeigen sein wahres Gesicht. Doch wie’s da drin aussieht, geht niemand was an.«
Ehe Johann in den Krieg musste – das hast du oft erzählt –, seid ihr ja auch in der Volksbühne gewesen, im damals noch prunkvollen Augsburger Stadttheater. Ihr habt auf Faschingsbällen getanzt und Filme mit Asta Nielsen unn Greta Garbo angesehen und Chorkonzerte im Ludwigsbau oder im Herrlesaal besucht, mit mehreren hundert Besuchern! Und dass du Johann auf einem Jazzkonzert kennengelernt hast, Anfang der 30er-Jahre, das hast du immer betont. Schön muss das gewesen sein!
Aber in den knapp zwanzig Jahren, die wir gemeinsam als Familie im Haus in der Gartenstadt Spickel lebten, von der frühen Kindheit bis zu meinem Abitur, seid ihr nicht ein einziges Mal ausgegangen, weder ins Theater noch ins Konzert oder Kino, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Es wäre wohl zu teuer gewesen.
4. Abstand halten
Wir leben jetzt im »social distancing«, Mama, würde ich dann erzählen, stell dir das mal vor!
Da ändert sich plötzlich der Ton deiner Stimme: Was ist denn das für ein komisches Wort? Muss man heute alles auf Englisch sagen? Was soll das denn heißen, »social distancing«? Du klingst jetzt richtig ungehalten, und mir verschlägt es erst mal die Sprache. So ein Unsinn, bemerkst du noch, eine soziale Distanz hat es doch immer gegeben, und das war auch richtig so!
Dein Tonfall wird jetzt streng, wie er manchmal war, wenn ich, das Kind, nicht gehorchen wollte oder eigene Ideen darüber hatte, was gut und richtig wäre. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Jeder kann heutzutage herausplappern, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist – findest du das gut? In euren seltsamen Computergesprächen gibt es keinen Respekt mehr, egal aus welchem sozialen Stand jemand kommt. Das hat es früher nicht gegeben. »Gehe nicht zum Fürscht, wenn du nicht gerufen wirscht!«
Ja, das liegt mir noch in den Ohren, wie habe ich diesen Spruch gehasst! Jetzt muss ich aber endlich sagen, dass es darum gar nicht geht: Wir können niemanden besuchen, Mama, und niemanden einladen, und dürfen nur mit den Personen aus dem eigenen Haushalt spazieren gehen, also zum Beispiel ich und mein Mann, und Familien mit ihren Kindern natürlich – und das alles mit zwei Meter Abstand zu den anderen Leuten, am besten mit Mundschutz!
Ach so ist das, sagst du zögernd, dann wieder Schweigen, schließlich ein wehmütiger Seufzer: Niemanden besuchen, keine Einladungen? Natürlich erinnerst du dich jetzt an Familienfeste, mit Johanns Brüdern und deren Familien, mit deinem Bruder und seiner Frau, mit Johanns Kollegen aus der Druckerei oder den »Mädchen« aus dem Textilgeschäft, die du ausgebildet hast – das war schön, ja, aber auch das alles lag lange zurück, in den Jahren vor dem Krieg.
Als ich ein Kind war, kam manchmal ein Onkel zu Besuch, um dem Vater bei einer Reparatur im Haus zu helfen, und blieb vielleicht zum Abendessen: Schwarzbrot mit Leberkäse, ein Fläschle Bier für jeden. Und meine Taufpatin, die Tante Marie, haben wir manchmal in ihrem Häusle am Stadtrand besucht, zum Nachmittagskaffee auf der Terrasse. Ihr Mann, dein Bruder, Mama, war ja schon in den Sechzigern an Krebs gestorben, kurz nachdem er das Häusle fertiggebaut hatte, und die Witwe pflegte viele Jahre lang ganz allein den Garten mit den schönen Blumen. Wir mussten immer einen bestimmten Bus nehmen, und dann noch ca. 20 Minuten zu Fuß über einen Feldweg gehen, um zu der neuen Eisenbahnersiedlung vor der Stadt zu gelangen. Der Bahnbus, mit dem die Tante täglich zu ihrer Arbeit in einem Büro in der Innenstadt gelangte, hätte extra gekostet. So stapften wir abends in der Dunkelheit mit der Taschenlampe zu unserer Haltestelle am Stadtrand.

5. Schwimmbadverbot
Am meisten fehlt mir das Schwimmbad, Mama, würde ich nun noch sagen. Du weißt ja, ich gehe seit Jahren normalerweise fast jeden Tag, und Anfang Mai sollte das Freibad öffnen, aber da wird wohl nichts draus, vielleicht bleibt es den ganzen Sommer zu! Kannst du verstehen, wie sehr mir das fehlt? Bist du nicht selber im Schwimmverein gewesen als junges Mädchen?
Jetzt schweigst du eine Weile, lächelst aber wieder. Ja, zusammen mit dem Bruder, der ein guter Sportler war, bin ich ein paarmal hingegangen, in das Bad im Norden der Stadt, ganz nahe bei unserer Wohnung, die »Schwimmschul« nannten wir es immer. Aber eigentlich hatten wir ja nur am Sonntagvormittag Zeit. Damals gab es noch keinen Achtstundentag, und auch den ganzen Samstag wurde gearbeitet. Meistens musste ich der Mutter am Sonntagvormittag beim Putzen des Lebensmittelladens helfen. Und der Bruder ging in den Schwimmverein mit seinen Freunden.
6. Verschlossene Kirchen
Und wie war es eigentlich bei euch mit der Kirche, Mama? Die war doch immer am Sonntagvormittag, auch damals! Und jetzt, stell dir vor, es dürfen gar keine Gottesdienste stattfinden, und die Proben unserer Kantorei fallen auch aus, sogar der feierliche Abschiedsgottesdienst unseres Pfarrers.
Ja, du nickst und lächelst auch jetzt, das kannst du verstehen! Und dann erzählst du vielleicht wieder von dem einzigen Mal, wo du als junges Mädchen im Chor der St. Josefs-Kirche in Augsburg-Oberhausen auf der Empore gestanden und mitgesungen hast: »Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre.« Du hättest doch so eine hübsche Stimme, habe der Herr Pfarrer Döllgascht zu deiner Mutter gesagt, aber es sei bei dem einen Mal geblieben.
Diese Geschichte habe ich oft von dir gehört, Mama.
Ich selber singe in Chören, seit ich 13 bin, und ihr habt es mir nie verboten.
7. Keine Reisen
Und reisen können wir auch nicht, Mama! Alle Hotels mussten schließen, und die Grenzen zu Italien und Österreich werden noch lange zu bleiben. Wir machen Tagestouren mit den Fahrrädern und nehmen unser Picknick im Rucksack mit. Die Schwäbische Alb ist schön, auch ohne Einkehr in einer Waldwirtschaft.
Du nickst und schweigst wieder eine Weile.
Pass auf dich auf, Kind, würdest du dann sagen. Mit dieser Krankheit ist offenbar nicht zu spaßen. Sorg für guten Schlaf, koch was Gutes und Gesundes für dich und deinen Mann und bewegt euch an der frischen Luft! Setzt euch nur aufs Fahrrad und genießt den herrlichen Frühling in eurem schönen Neckartal. Hast du nicht was von elektrischen Fahrrädern erzählt? Sowas kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, aber das hätte ich mir auch gewünscht, als ich alt wurde und mich nicht mehr aufs Rad traute im Augsburger Stadtverkehr, oder zu kleinen Ausflügen mit deinem Vater, als der noch lebte.
Ja, das machen wir, Mama, sage ich. Es ist ja jetzt wirklich traumhaft schön draußen, die Bäume blühen auf den Streuobstwiesen und wir hören ganz unbekannte Vogelstimmen, weil keine Flugzeuge mehr lärmen. Sogar eine Schwanzmeise haben wir neulich gesehen, am Vogelhäuschen.
Dass wir früher immer gern zu eine Ausflugsziel geradelt sind, wo man gemütlich einkehren kann, sage ich nicht. Denn ich weiß, was du darauf erwidern würdest, Mama:
Dass ihr manchmal Bergtouren gemacht habt, an einem einzigen Tag, in aller Herrgottsfrühe mit dem Zug losgefahren seid, ihr hattet ja kein Auto, in den Jahren vor dem Krieg, du und Johann und manchmal einer seiner Brüder, Getränkeflaschen aus Blech und mit Leberkäs belegte Brote im Rucksack, und spät abends nachhause gefahren mit dem letzten Zug, damit ihr am Montag Morgen wieder zur Arbeit gehen konntet – an eine Übernachtung war nicht zu denken.
Ich erinnere mich an die Fotos aus eurem Leben vor dem Krieg, wo ihr lachend in Trachtenkleidung vor hohen Bergen oder altmodischen Bauernhäusern steht.
Als ich ein Schulkind war, sind wir zweimal je eine Woche lang verreist, nach Österreich und sogar an den Gardasee, mit dem Reisebus in einfache Pensionszimmer. Im »Römischen Keller« in Kuchl an der Salzach, wo wir die ganze Urlaubswoche lang das Hochwasser aus der Wohnung unserer Wirtsleute schöpften, gab es »Essigwurst«, die bei uns zuhause Wurstsalat hieß – die Namen habe ich mir gemerkt. Und waren wir je in einem Restaurant, als ich ein Kind war? Vielleicht bei meiner Erstkommunion, bei der Firmung? Ich erinnere mich nicht.
Aber zu Ostern, das würde ich dann doch noch erzählen, haben wir uns aus der Dorfwirtschaft in der Nähe ein schönes Essen liefern lassen, Mama, das hätte dir auch geschmeckt: Schwäbischer Rostbraten mit Spätzle und Salat! Die liefern nämlich jetzt, wo sie das Restaurant nicht öffnen dürfen.
Da habt ihr recht, würdest du sagen, Mama, dann verdient der Wirt auch was! Das kann er jetzt sicher brauchen.
Und dann würdest du mir einen Geldschein zustecken, wie du es in meinen Studentenzeiten oft gemacht hast: Da, nimm des! Ich brauch ja jetzt nimmer soviel, ich hab ja alles!
______
Alle Beiträge des Erzählprojektes »Die Liebe in Zeiten von Corona«
______
Jeden Morgen kostenlos per E-Mail: Spiritletter von Publik-Forum
Dies ist ein Beitrag im Rahmen des Erzählprojektes von Publik-Forum »Die Liebe in Zeiten von Corona«. Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein zu unserem Erzählprojekt: Bitte schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, Nöte, Ängste und Ihre Zuversicht in Zeiten von Corona.



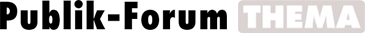
 Die Liebe in Zeiten von Corona
Die Liebe in Zeiten von Corona