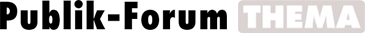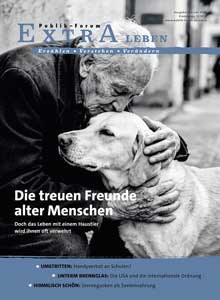Ein Buch fürs Leben …
Gebrochene Lebenslinien
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Man denkt an mich, also bin ich« – dieser Schlüsselsatz geht mir nach. Über Menschen im Exil formulierte der Philosoph, Dichter und Schriftsteller Günther Anders 1962 diesen Satz in seinem Essay »Der Emigrant« für die Zeitschrift »Merkur« – und bringt eine entscheidende Selbsterfahrung auf den Punkt. Der weithin unbekannte Essay ist 2021 neu erschienen (mit Kommentar bei C. H. Beck, 86 Seiten), denn die Welt ist voller Flüchtender und Geflüchteter und Verfolgter wie kaum je zuvor. So habe ich die Neuveröffentlichung gelesen und bekam zu Flucht, Vertreibung, Exil und Migration noch mal einen anderen Zugang. Existenzieller, prinzipieller. Die »Philosophie der Migration«, schreibt der Philosoph Florian Grosser in seinem Nachwort, ist »erst unter heutigen Bedingungen in ihrer vollen Tragweite erkennbar«. Es wühlt mich auf, die Einsichten in die Verlorenheit, die empfundene und gespiegelte Schande, das Stammeldasein der Exilanten. Denn sie können die Sprache der Fremde meistens nicht, müssen sich behelfen mit Bruchstücken, radebrechen, stammelnd sich verständlich machen. Da bleibt auch mir die Klugheit vieler Flüchtender und Migranten, ihre Intellektualität, ihre Belesenheit und Kulturkompetenz unhörbar. Und das macht dem Emigranten Günther Anders sehr zu schaffen; nimmt ihm Identität. Er schreibt über seine Emigration wie auch Immigration, ausgelöst durch die nationalsozialistisch-deutsche Judenverfolgung. Anders, der eigentlich Stern hieß, musste sich in sehr vielen Artikeln in einer Berliner Zeitung ein Pseudonym zulegen. Er war der Sohn des jüdisch-deutschen Psychologenehepaares William und Clara Stern aus Breslau, die beide hervorragende Forscher in der Entwicklungspsychologie der frühen Kindheit waren. Von 1929 bis 1937 war Günther Anders mit der politischen Philosophin Hannah Arendt verheiratet. Er emigriert 1933 nach Paris, sie ein Jahr später. Es folgten 14 Jahre Exil in den USA, danach in Wien, wo der Neunzigjährige 1992 stirbt. Anders war nicht nur ein sehr gebildeter, kritischer und kreativer Kopf, sondern vor allem ein entschiedener Kritiker des mechanisch-materialistisch-nuklearen Zeitalters (siehe sein Werk »Die Antiquiertheit des Menschen«, 2 Bände, C. H. Beck). 1943 war schon der Essay »Wir Flüchtlinge« seiner Frau Hannah erschienen, wurde lange Zeit ignoriert und erst 1986 übersetzt (mit Kommentar, Reclam, 64 Seiten). Während Günther Anders phänomenologisch-psychologisch besonders den Selbstverlust in der Fremde und die gebrochene eigene Lebenslinie – »Leben im Plural« – thematisiert, setzt Hannah Arendt den Schwerpunkt bei historischen, politik- und rechtstheoretischen Aspekten. Beide stimmen jedoch darin überein, wie Hannah Arendt schrieb: »Wenn wir gerettet werden, fühlen wir uns gedemütigt, und wenn man uns hilft, fühlen wir uns erniedrigt.« Und: »Nur sehr wenige Individuen bringen die Kraft auf, ihre eigene Integrität zu wahren, wenn ihr sozialer, politischer und juristischer Status völlig verworren ist.« Anspruchsvoll für Einheimische wie Heimatlose.
Norbert Copray ist geschäftsführender Direktor der Fairness-Stiftung. Er leitet seit 1977 das Rezensionswesen von Publik-Forum.