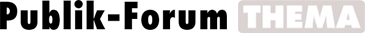Zum Tee bei Schelling ...
Die Wahrheit erschauen
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Zugang:

Weiterlesen mit Ihrem Digital-Upgrade:
- Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement
- Mehr als 34.000 Artikel auf publik-forum.de frei lesen und vorlesen lassen
- Die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper erhalten
- 4 Wochen kostenlos testen

Jetzt direkt weiterlesen:
- diesen und alle über 34.000 Artikel auf publik-forum.de
- die aktuellen Ausgaben von Publik-Forum als App und E-Paper
- 4 Wochen für nur 1,00 €
Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden

Sie haben bereits ein  -Abo? Hier anmelden
-Abo? Hier anmelden
Verehrter Herr Schelling, es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um hier in Berlin bei einer Tasse Tee über Ihre Philosophie zu sprechen. Berlin ist der Ort, an dem Sie zuletzt Vorlesungen gehalten haben – vor einem äußerst illustren Publikum, dem unter anderem Alexander von Humboldt, Sören Kierkegaard und Michael Bakunin angehörten. An Ihre Vorlesungen richteten sich große Erwartungen, obgleich Ihre philosophischen Gedanken nicht leicht zu verstehen sind. Wollen wir versuchen, ein paar Grundideen Ihres philosophischen Ansatzes zu skizzieren, und dabei über Ihre Vorstellung vom Philosophieren sprechen?
Schelling: Ja, das können wir gerne machen. Es freut mich, wenn daran in Ihrer Zeit Interesse besteht. Ich habe die Lehrtätigkeit unter anderem deshalb aufgegeben, weil
Dagmar Borchers
ist
Professorin für angewandte
Philosophie an der Universität Bremen. Sie publiziert zu
Fragen der Ethik (unter
anderem
Tierethik, Medizinethik und Bioethik, Kritik der Tugendethik) und der Politischen
Philosophie.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) war der Hauptbegründer der spekulativen Naturphilosophie, die von etwa 1800 bis 1830 in Deutschland fast alle Gebiete der damaligen Naturwissenschaften prägte. Seine Philosophie des Unbewussten hatte Einfluss auf die Ausbildung der Psychoanalyse. Schelling stammte aus einer alteingesessenen schwäbischen Pfarrersfamilie. Der Vater Joseph Friedrich Schelling war ein angesehener Orientalist. Das intellektuelle Milieu in Schellings Elternhaus war geprägt durch die protestantische Mystik und pietistische Innerlichkeit und sollte nicht ohne Einfluss auf Schellings spätere Philosophie bleiben.